„Ich bin keine Hexe.“ Ein Spagat zwischen Aberglauben und Fortschritt
Ein Dorf, gelegen in einem Moorgebiet, abgeschottet von benachbarten Orten, wird nach dem Zweiten Weltkrieg überwiegend von Frauen und Kindern bewohnt. Genau hier befindet sich der Schauplatz des neuen Romans von Helga Bürster. In dem abgeschiedenen Provinznest ist wenig Fortschritt erkennbar, das Leben gestaltet sich eher noch wie im 19. Jahrhundert. Die Menschen leiden an den fatalen Kriegsfolgen, die auch sie getroffen haben. Viele Männer gelten als verschollen, Mütter müssen ihren Alltag mit dem Nachwuchs und den weiterhin vorhandenen Pflichten allein bestreiten. Genau hier leben die anfangs elfjährige Betty Abels und ihre Mutter Edith, auch ihr Vater und Ehemann ist nach dem Krieg nicht wieder aufgetaucht. Wie soll es also weitergehen?
Nebenan wohnen der etwas zurückgebliebene Willi, den Betty wie einen Bruder behandelt, und seine Mutter Anni. Auch ihm ist das gleiche Schicksal widerfahren. Doch dann taucht sein Vater Josef plötzlich wieder auf, völlig verändert, und schenkt Edith Aufmerksamkeit - statt seiner Ehefrau. Das bringt böse Schwingungen in Bewegung, denn die einzige Erklärung hierfür sucht seine Frau Anni im Aberglauben: Edith muss ihren Mann verhext haben!
Neben diesen privaten, aber nach außengetragenen folgenreichen Konflikten, soll nun auch noch das Moor trockengelegt werden. Gelangt jetzt doch ein wenig Fortschritt nach Unnenmoor?
Das Interesse der Autorin an der Thematik
Angelehnt an wahre Begebenheiten schildert die Autorin ein Leben voller Entbehrungen und den Spagat zwischen Aberglauben und dem progressiven Schritt nach vorne. Der Glaube an Hexen und Wunderheiler steht in Zusammenhang zur Hoffnungs- und Orientierungslosigkeit der Dorfgemeinschaft. Auch die karge, harte und anstrengende Landschaft trägt ihren Teil dazu bei. Autorin Bürster zeigt sich in einem Interview erstaunt, dass diese Vorgänge- und auch besonders der Hexen- und Aberglaube - im Nachkriegsdeutschland noch vorhanden sind. Aus dieser Verwunderung heraus wuchs, nach eigenen Angaben, ihr Interesse an dieser Thematik.
Sie beginnt in Archiven zu recherchieren und Zeitzeugen zu befragen, um möglichst authentisch schreiben zu können. Ihr gelingt es, dieses Gefühl transparent zu machen und in ihre Erzählung einzuflechten. Zu Beginn sind der Einsteig und das Einfinden in das Geschehen etwas sperrig, man muss erst einmal einige Seiten gelesen haben, um in einen gewissen Lesefluss zu gelangen. Ab da aber nimmt das Ganze Fahrt auf und man kann mit den Figuren mehr oder weniger warm werden. Zwischendurch lässt Bürster die Figuren mit dörflichem Dialekt sprechen und erzielt so das Nachempfinden der Heimatnähe der Bewohner Unnenmoors. Auch die Aggressivität Annis, die hinterher sogar mit einem Gewehr auf die Frauen losgeht, sich von Hexenmeister Fritz bequatschen und ihren Mann todkrank im Bett liegen lässt, ist fast körperlich spürbar.
Fazit
„Ich bin keine Hexe.“ Genau diesen Ausspruch wirft Edith ihrer Rivalin Anni entgegen, die glaubt, sie habe ihren aus dem Krieg zurück gekehrten, stark traumatisierten Mann mit ihrer Schönheit im wahrsten Sinne des Wortes verzaubert. Diesen Aberglauben noch in der dörflichen Gemeinschaft Unnenmoors während der Nachkriegszeit zu finden, verwundert beim Lesen. Die Autorin vermag es, genau diese Stimmung zwischen Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Misstrauen und dem Glauben an magische Kräfte dem des modernen Fortschritts entgegenzusetzen.


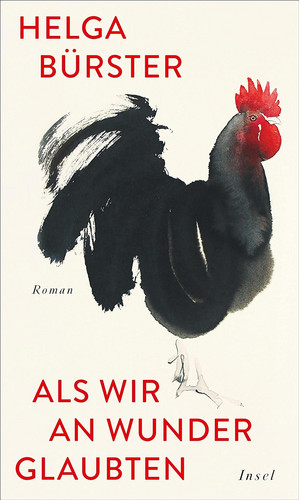

Deine Meinung zu »Als wir an Wunder glaubten«
Wir freuen uns auf Deine Meinungen. Ein fairer und respektvoller Umgang sollte selbstverständlich sein. Bitte Spoiler zum Inhalt vermeiden oder zumindest als solche deutlich in Deinem Kommentar kennzeichnen. Vielen Dank!